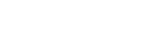Zukunftsszenarien – Was die Ölkrise, Kraniche und die Wirtschaftspolitik Südafrikas miteinander zu tun haben
- Posted by Alice Rombach
- On 20. August 2025
- Fiktion
Traditionelle Planung basiert auf Prognosen. Dies beruht auf einer Denkweise, dass die Welt von morgen ähnlich sein wird, wie die von heute. In den relativ stabilen 1950er und 1960er Jahren in der westlichen Welt funktionierte das ziemlich gut, aber seit den frühen 1970er Jahren immer weniger. Warum? Seit den 1990er Jahren wird der Begriff VUCA-Welt, ein Akkronym aus dem US-Militär als Erkärungsgrundlage verwendet. Er steht für Volatilität (Flüchtigkeit) – Ungewissheit – Komplexität – Ambiguität (Mehrdeutigkeit). Wir leben in einer Welt, die sich ständig verändert.
[blockquote] Veränderung fand immer statt – tatächlich als die wahrscheinlich einzige sichere Kontinuität. Wandel nun allerdings findet in schnellerer Abfolge – mit immer unberechenbareren Auswirkungen statt. [/blockquote]
Die Ölkrise 1973 – eine Wild Card? Und eine kleine zusätzliche Klausel im Vertrag
In den 1950er Jahren begann ein Team unter der Leitung von Herman Kahn, in der Rand Co-operation, eines Gemeinschaftsprojekts der US Airforce und von Douglas Aircraft, Szenarien anhand spieltheoretischer Methoden mit den möglichen Folgen eines Atomkriegs für das amerikanische Raketenabwehrsystem zu entwickeln. Dies gilt als die Geburtsstunde der modernen Szenarioplanung wie sie heute verwendet und weiterentwickelt wird.
Als im Herbst 1973 der Jom-Kippur-Krieg ausbrach, wurde sehr schnell wie in einem Dominospiel eine Kettenreaktion in Gang gebracht. Aus Verärgerung über die westliche Unterstützung Israels drosselten die OPEC sofort die verfügbaren Ölmengen extrem. Die Folge war globale Treibstoffknappheit und sehr schnell eine weltweite Rezessionen und diese löste wiederum einen Börsencrash aus. In diesem Taumel, gab es ein Unternehmen, das zwar den Zeitpunkt nicht gekannt hatte, aber von dieser Ölkrise 1973 dennoch nicht unvorbereitet getroffen wurde. Was war passiert?
Basierend auf der Methode von Herman Kahn, übertrug Pierre Wack als erster den Einsatz der Szenarioplanung in das unternehmerischen Umfeld der britischen-niederländischen Ölfirma Royal Dutch Shell im Londoner Headquarter.
Eine Ölkrise – stark ansteigende Ölpreise und rasant sinkende Fördermengen – wurde zum damaligen Zeitpunkt für eine sehr unwahrscheinliche Entwicklung gehalten. Dementsprechend wurden Royal Dutch Shell und das neu entstandene Szenario-Forschungsteam auch in ihren Kreisen belächelt, als sie eine Studie über die Folgen einer derartigen potentiellen Öl-Krise erarbeiteten. Sie stellten jedoch fest, dass es möglicherweise in diesem Szenario zu langen Liegezeiten der Öltanker in den Häfen überall auf der Welt führen könnte. Ein plötzlicher Anstieg dieser sehr teuren Hafengebühren würde die Transportkosten extrem in die Höhe treiben. Deshalb erweiterten die firmeninternen Juristen vorbeugend ihre Verträge mit den Reedereien um eine Klausel, die sie im Falle verlängerter krisenbedingter Liegezeiten von genau diesen Gebühren entband. Für eine übervorsichtige Spinnerei gehalten, wurden die neuen Verträge durchgewunken. Auch 1981 nach dem Ausbruch des iranisch-irakischen Krieges, wiederholten das Unternehmen ein ähnliches Kunststück, indem sie ihre überschüssigen Mengen bereits verkauften hatten, bevor der Preis aufgrund des übersättigten Marktes völlig einbrach, während andere Unternehmen ihre Reserven noch aufstockten. Die Entscheidungsträger bei Royal Dutch Shell hatten sich mental auf diverse mögliche dramatische Situationen vorbereitet. Sie hatten in ihren Köpfen und Schubladen große, detailreiche, farbige Bilder verschiedener Zukunftslandschaften.
Mit ihrer unkonventionellen Vorgehensweise hatten sie das traditionelle Managementdenken zu dieser Zeit völlig infrage gestellt. Der dadurch ausgelöste Hype beruhigte sich in den nächsten Jahrzehnten wieder. Erst in den 2000er Jahren rückte die Szenarienplanung wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit – dafür fand sie um so nachhaltiger in ihrer Bedeutung für Unternehmen, Beratung und Wissenschaft.
Transformative Szenarien – Kraniche über Mont Fleur
In der Zwischenzeit war jedoch ein anderes großes und erfolgreiches Szenarienprojekt durchgeführt worden. In seinem Charakter der politischen Ausrichtung eines ganzen Landes hatte es allerdings einen anderen Fokus. Es blieb zwar insgesamt weniger bekannt, hat aber die Richtung der transformativen Szenarienplanung, die vor allem im politischen und sozialen Projekten eingesetzt wird, maßgeblich beeinflusst.
Adam Kahane war in London bei Shell als Leiter des Szenario-Teams des Unternehmens tätig. Die Aufgabe dieses Teams war es weltweit nach globalen sozialen, politischen, wirtschaftlichen und ökologischen Signalen des Wandels zu suchen, um mögliche Zukunftsszenarien zu entwerfen, um die unternehmenseigenen Strategien robuster und anpassungsfähiger zu machen.
Nelson Mandela war im Februar 1990 aus dem Gefängnis entlassen worden und der bekannte African National Congress (ANC), aber auch andere Parteien und Organisationen waren legalisiert worden. Bevor im April 1994 die ersten Wahlen nach dem Ende der Apartheid stattfinden sollten, wurden in Südafrika vielfältige „Foren“ mit möglichst vielen Interessengruppen wie politische Parteien, zivilgesellschaftliche Organisationen, Berufsverbände, Regierungsstellen, Gewerkschaften und Unternehmensgruppen durchgeführt, um neue gesellschaftspolitische Wege zu bahnen.
Im sogenannten Mont-Fleur-Projekt, an dem Adam Kahane 1991/92 mitwirkte, wurde eine vielfältige Gruppe von 22 prominenten Südafrikanern – Politiker, Aktivisten, Akademiker und Geschäftsleute aus dem gesamten ideologischen Spektrum – zusammengebracht. Ziel war es, inmitten einer Umbruchszeit und tiefen Konfliktlinien Menschen aus verschiedenen Organisationen zusammenzubringen, um kreativ und innovativ über die Zukunft ihres Landes – die Gestaltung der nächsten 10 Jahre – nachzudenken.
Die Ergebnisse dieses Projekts brachten Szenarien hervor, die symbolisch nach unterschiedlichen Vögeln benannt wurden und über Zeitungen überall im Land verbreitet wurden. Sie wurden damit zur Blaupause für die südafrikanische Wirtschaftspolitik für die folgenden zehn Jahre.